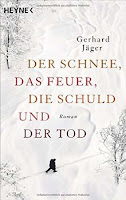Ansehnlich ist das 1985 erschienene Buch (diese Ausgabe: 1993) vor allem durch die edle Gestaltung. Kosters stimmungsvolle Fotografien von Wäldern, Küsten, Felsen im Nebel, Burgzinnen im Nebel, und Sonnenuntergängen mit und ohne Nebel führen die Schauplätze der Sage vor Augen. Als Bildunterschriften dienen Zitate aus Thomas Malorys Le Morte d'Arthur, die einmal kursorisch durch den berühmtesten aller Artus-Romane führen.
Schwer getan habe ich mir mit dem (schick weiß auf schwarz gedruckten) Text, einem Essay des belgischen Schriftstellers Hubert Lampo. Seine Gedanken zur Artussage sind nur für diejenigen nachvollziehbar, die sich bereits gut mit dem Stoff auskennen - einen Überblick für Einsteiger bieten sie nicht. Gleichzeitig ist aber auch nichts wirklich Neues vorgebracht.
Lampo beschäftigt sich sehr umfassend mit verschiedenen literarischen Zeugnissen. Manchmal tut er das in launigem, originellem Ton, meist aber recht akademisch trocken. Letzteres gilt besonders für seine abschließenden Ausführungen zum Jungschen Archetypen und dem Mythos an sich.
Er führt Belege auf, dass Artus wirklich als britisch-römischer Heerführer existiere, ruft die altbekannten, möglichen Schauplätze wie Tintagel (Artus‘ Geburt), Cadbury (Camelot) und Glastonbury (Avalon) ins Gedächtnis. In einem zweiseitigen Anhang sind die mutmaßlichen Artus-Orte in Fotografien abgebildet (siehe Foto).
Interessant und aktuell sind die Gedanken, die sich Lampo zum siechen König macht, der (von der alles entscheidenden) Frage geheilt werden muss, oder aber (in anderen Bearbeitungen des Stoffes) Platz für einen vitaleren, vatermordenden Nachfolger machen muss - weil sonst das ganze Land siecht und zugrunde geht. Der kranke Herrscher, dessen Zeit vorüber ist, und der Unheil über das ganze Land bringt: Eine Metapher, die jetzt, im März 2022, da der Ukraine-Krieg tobt, aktueller denn ist.